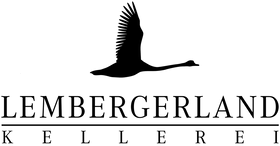Die Vielfalt der Weininhaltsstoffe ist manchmal fast unbeschreiblich – und das im wahrsten Wortsinn. Grüne Äpfel, Bananen, Quitten, Kirschen, Brombeeren, Dörrobst, Minze, Pfeffer, Tabak, Nelken, Leder oder Waldboden – all das und noch viel mehr lässt sich im Wein erschnüffeln, je nachdem, was man gerade im Glas hat.
Stimmt’s? Nein! Schließlich werden weder Bananen, noch Pfeffer, noch Waldboden verarbeitet. Auch Feuersteine gibt es nicht im Wein. Was wir riechen, sind Alkohole, flüchtige Säuren (Essig), Pyrazine (grüner Paprika), flüchtige Phenole (von Brettanomyces bis Röstaromen), Thiole (von Grapefruit bis Mercaptanböckser), Terpene (von Muskat über Rosenblüten bis Zitrusfrüchte), Ester (von Banane bis Nagellack), Lactone (ringförmige Ester), Aldehyde und Ketone (von Zimt über Vanille bis Aceton) oder Sulfide (von Knoblauch bis faule Eier). Für den Geruch und auch den weitaus größten Teil des Geschmacks von allem, was wir zu uns nehmen, sind die genannten flüchtigen Stoffe verantwortlich, die wir mit der Nase und zu einem großen Teil über unser retronasales System, also über den Mund, wahrnehmen. Wir riechen über den Mund und bezeichnen den Eindruck als Geschmack.
Am deutlichsten wird das bei einem starken Schnupfen: Wenn die Nase zu ist, weil das olfaktorische Zentrum (die Rezeptoren im Nasenraum) verschleimt ist, ist der Geschmack weg. Unser Geruchssinn übernimmt definitiv den weit überwiegenden Part bei der Weinbeurteilung, auch wenn meist von Weingeschmack die Rede ist. Bekanntlich spielen für die Weinbeurteilung zusätzlich die Weinfarbe und der Eindruck am Gaumen, das Mundgefühl, eine große Rolle. Neben den Augen hat hier die Zunge ihre Aufgabe – auch wenn sie nur süß, sauer, salzig, bitter und umami detektieren kann. Süßes und Säure werden am häufigsten angesprochen, aber auch bitter ist ein häufig verwendeter Begriff, vor allem, wenn kritisiert wird.
Hier kommen die nicht flüchtigen, die nicht riechbaren Phenole ins Spiel. Von der Stoffgruppe der Phenole war an dieser Stelle schon sehr häufig die Rede. Sie zählen zu den sekundären Pflanzenstoffen, von denen heute rund 8.000 bekannt sind und die den Pflanzen als Farbstoffe, Bitterstoffe, Aromastoffe oder Phytoalexine dienen. Letztere sind Abwehrstoffe gegen Fressfeinde, also Giftstoffe, deren letale Wirkung der Mensch schon sehr früh zu nutzen gelernt hat.
Die Menschen haben aber auch schon vor tausenden von Jahren gewusst, dass Pflanzen gesundheitsfördernd und sogar heilend wirken können. Sie wussten nur nicht, aus welchem Grund. Heute hat die Wissenschaft weitreichende Kenntnis von der Wirkung der sekundären Pflanzenstoffe, die auch zahlreich im Wein vorkommen. Relativ häufig ist dabei von Resveratrol die Rede, das durch das sogenannte „French Paradox“ bekannt wurde. Resveratrol zählt zu den Stilbenen. Anthocyane, die Pflanzenfarbstoffe, sind Flavonoide, benannt nach Balkonpflanzen. Und schließlich sind da die Anthocyane, die Farbstoffe im Wein, die zu den Flavonoiden zählen. Flavonoide sind innerhalb der Phenole eine Gruppe relativ kleiner Moleküle, die häufig zu längeren Ketten aneinandergefügt werden und dadurch völlig neue Wirkungen entfalten. Dazu zählt zum Beispiel das Catechin, aus dem durch Polymerisation, durch die Verkettung zahlreicher Catechinmoleküle, das Tannin entsteht. Auch die Flavonole sind eine Untergruppe der Flavonoide. Sie kommen in vielen Obst- und Gemüsesorten vor und haben – wie viele sekundäre Pflanzenstoffe – antioxidative Wirkung. Laut einer amerikanischen Studie sollen sie sogar dem kognitiven Abbau, also einer im Alter nachlassenden Hirnleistung, entgegenwirken. Die bereits erwähnten Anthocyane, die Pflanzenfarbstoffe, wirken ebenfalls durchblutungsfördernd und gefäßschützend. Sie heißen Pelargonidin, Petunidin oder Malvidin – klingt stark nach Balkonkasten.
Und übrigens: Meinungsverschiedenheiten bei der Weinbeurteilung entstehen durch die individuelle Wahrnehmung jedes Einzelnen, durch eine multisensorische Erfahrung, die über drei Sinneskanäle zum Gehirn gelangt: Nase, Gaumen und physikalische Empfindungen (Temperatur, Kohlensäure). Wenn also in einer Probe über einen Wein diskutiert wird, liegt es schlicht in der unterschiedlichen Wahrnehmung der Teilnehmer begründet. Das heißt, jeder, der Wein verkostet, hat in seiner Empfindung recht.
Und darauf einen komplexen Riesling Meisterwerk. Zum Wohl