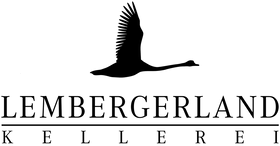Steillagenkollektiv

Artenvielfalt
Trockenmauerbau im Weinberg und die tierischen Bewohner
Trockenmauern sind nicht nur ein traditionelles Element der Weinbaukultur, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Landschaftspflege. Sie bieten nicht nur eine stabile Struktur zur Abgrenzung von Parzellen, sondern fördern auch die Biodiversität in Weinbergen.
Der Trockenmauerbau
Um eine Trockenmauer im Weinberg erfolgreich wieder aufzubauen, ist es wichtig, geeignete Steine auszuwählen, die lokal verfügbar sind und gut zur Umgebung passen. Ideale Materialien sind Natursteine wie Muschelkalk, Granit, Kalkstein oder Sandstein. Die Steine müssen unterschiedliche Größen haben, um eine stabile Struktur zu gewährleisten.
Zu den Werkzeugen gehören neben viel Muskelkraft eine Schaufel, ein Spaten, ein Hammer, ein Meißel, eine Wasserwaage, eine Schnur oder Richtschnur sowie Handschuhe und eine Sicherheitsbrille.
Falls Teile der alten Mauer noch vorhanden sind, werden diese vorsichtig entfernt. Dabei ist es wichtig, die Steine nicht zu beschädigen, da sie möglicherweise wiederverwendet werden können. Anschließend wird ein Fundament für die neue Mauer erstellt. Hierzu wird ein Graben ausgehoben, der etwa 30 cm tief sein sollte – je nach Größe der Steine kann dies variieren. Der Graben sollte breiter sein als die geplante Mauer. Der Graben wird dann mit einer Schicht grobem Kies oder Schotter von etwa 10 cm Dicke aufgefüllt, um eine gute Drainage zu gewährleisten.
Nun beginnt der eigentliche Mauerbau. Es wird die erste Reihe von Steinen am unteren Ende des Hangs oder des Geländes gelegt und man verwendet zuerst die größten Steine. Dies müssen sehr stabil liegen und eine gerade Linie bilden. Eine Wasserwaage hilft dabei sicherzustellen, dass die Steine eben sind.
Nun kommen weitere Steinreihen hinzu. Es werden kleinere Steine für die oberen Reihen verwendet und Hohlräume zwischen den größeren Steinen mit kleineren Steinen oder Kies aufgefüllt. Die Fugen zwischen den Steinen sollten versetzt sein – ähnlich wie bei einem Ziegelmauerwerk, da dies die Stabilität der Mauer erhöht. Es ist darauf zu achten, dass jede Reihe gut verankert ist und keine großen Lücken entstehen.
Die Oberkante der Mauer sollte leicht geneigt sein (ca. 5–10 Grad), um einen effektiven Wasserabfluss zu ermöglichen und Erosion zu verhindern. Zum Abschluss werden in den Ritzen und Spalten zwischen den Steinen Pflanzen wie Kräuter oder Wildblumen angepflanzt. Dies verbessert nicht nur das Erscheinungsbild der Mauer, sondern hilft auch dabei, Erosion zu verhindern.
Nach vielen schweißtreibenden Arbeitsstunden - ein großer Mauerstein wiegt gerne einmal 50 bis 70 Kilogramm - ist die Trockenmauer nicht nur ein schöner Anblick im Weinberg, sondern auch ein wertvoller Beitrag zur Landschaft und Artenvielfalt.
Tierische Bewohner der Trockenmauer
Nach dem Bau einer Trockenmauer entsteht ein neuer Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Die Ritzen und Spalten zwischen den Steinen bieten ideale Nist- und Rückzugsmöglichkeiten für verschiedene Tiere.
Eidechsen: Besonders häufig sind Zauneidechsen anzutreffen. Sie nutzen die warmen Steinoberflächen zum Sonnenbaden und finden in den Ritzen Schutz vor Fressfeinden.
Insekten: Trockenmauern sind ein Paradies für Insekten wie Bienen, Wespen und Käfer. Viele Arten nutzen die Mauern als Nistplatz oder Lebensraum. Wildbienen beispielsweise nisten oft in den Hohlräumen der Steine.
Vögel: Einige Vogelarten wie verschiedene Finkenarten nutzen die Mauern als Brutstätten oder Ruheplätze. Ihre Nester finden sie in den Spalten der Mauer.
Säugetiere: Kleinere Säugetiere wie Mäuse oder Igel können ebenfalls in den Hohlräumen leben oder sich dort verstecken. Diese Tiere tragen zur natürlichen Schädlingsbekämpfung im Weinberg bei.
Amphibien: In feuchteren Regionen können auch Amphibien wie Frösche oder Molche in der Nähe von Trockenmauern vorkommen, da diese Strukturen oft mit Feuchtgebieten verbunden sind.
Bedeutung für die Biodiversität
Die Schaffung von Trockenmauern fördert nicht nur die Artenvielfalt im Weinberg, sondern trägt auch zur ökologischen Stabilität des gesamten Ökosystems bei. Indem die Mauern Lebensräume für verschiedene Arten bieten, helfen sie dabei, das Gleichgewicht zwischen Pflanzenfressern und deren Fressfeinden aufrechtzuerhalten.
Darüber hinaus können gesunde Populationen von Nützlingen wie Insektenbestäubern dazu beitragen, die Erträge im Weinbau zu steigern und gleichzeitig den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren.
Fazit
Der Trockenmauerbau im Weinberg ist weit mehr als nur eine traditionelle Bauweise; er ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Biodiversität und zur Schaffung eines nachhaltigen Ökosystems. Durch das Verständnis der tierischen Bewohner dieser Mauern können Winzer nicht nur ihre Anbaumethoden optimieren, sondern auch aktiv zum Schutz der Natur beitragen. Die Kombination aus traditionellem Handwerk und ökologischer Verantwortung macht den Trockenmauerbau zu einem wertvollen Element im modernen Weinbau.

Biodiversität
Boden und Weinqualität, das Geheimnis des Terroirs
Die Rebe ist das Sprachrohr des Bodens – und das Lembergerland ist ein perfektes Beispiel dafür, wie unterschiedliche Bodenstrukturen den Charakter unserer Weine prägen. Hier treffen Muschelkalk im Enztal und Keuper im Stromberg aufeinander und schaffen ein einzigartiges Terroir, welches sich in unseren Weinen widerspiegelt. Der Boden ist nicht nur die Grundlage des Lebens, sondern auch der Schlüssel zu unseren Weinen. Deshalb gehen wir pfleglich mit ihm um.
Das Gedächtnis der NaturDer Boden speichert das Gedächtnis der Natur. In ihm leben unzählige Organismen, die zusammen das sogenannte Edaphon bilden – eine komplexe Gemeinschaft aus Bodenflora, Bodenfauna und Mikroorganismen. Ein Kubikmeter Boden kann beeindruckende 100 Billionen Bakterien, 100 Millionen Algen, 100 Millionen Geißeltierchen, 100 Millionen Pilze sowie zahlreiche Milben, Käfer, Regenwürmer und andere Lebewesen enthalten. Diese Vielfalt ist nicht nur faszinierend, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle für die Gesundheit unserer Weinreben.
Die Bedeutung der BodenpflegeDie Pflege des Bodens hat einen direkten Einfluss auf den Wasser- und Nährstoffhaushalt – und damit auf die Qualität unserer Weine. In trockenen Jahren kann eine wasserschonende Pflege den Extraktgehalt und die Ausdruckskraft der Weine erheblich verbessern. Zudem fördert sie die Stickstoffaufnahme, die für die Hefeernährung und Aromastoffbildung unerlässlich ist. Eine ausgewogene Vitalität des Laubes in der Reifephase unterstützt die Zuckerproduktion; jedoch kann zu hohe Vitalität das Risiko von Krankheiten wie Botrytis erhöhen.Im deutschen Weinbau ist es gängig, jede zweite Gasse offen zu halten und die andere mit Gras zu begrünen. Dieses System bietet jedoch wenig Abwechslung und Lebensraum für Pflanzen- und Tierarten. Eine vielfältige Pflanzengesellschaft dagegen kann die Artenvielfalt erheblich steigern, indem sie den Boden intensiver durchwurzelt, eine schattenspendende Streuschicht bildet und Nützlinge fördert.
Biodiversität im WeinbergEine beeindruckende Zählung in der Enzschleife in Mühlhausen ergab über 180 Nachtfalterarten – ein Beweis für die reiche Biodiversität in unseren Weinbergen! Um diese Vielfalt weiter zu fördern, sind schmale Blühstreifen in der Mitte der Gassen oder in den Weinbergterrassen eine praktikable Lösung. Diese Blühstreifen reduzieren die Wasserkonkurrenz zu den Reben und tragen gleichzeitig zur Erhöhung der Artenvielfalt bei.Um Blühstreifen effektiv zu integrieren, sind angepasste Bearbeitungstechniken erforderlich. Spezielle Mulcher für begrünte Gassen helfen dabei, diese wertvollen Flächen zu schonen.
Der Weg nach vornWinzer sollten individuelle Beobachtungen nutzen, um das richtige Maß an Bodenpflege für jede Parzelle zu finden. Die Kombination von angepasster Bewirtschaftung mit Blühstreifen könnte nicht nur die Biodiversität fördern, sondern auch positive Auswirkungen auf das Wachstum und die Erträge der Reben haben.Es wäre wünschenswert, dass Blühstreifen künftig fester Bestandteil des Bodenpflegesystems im Weinbau werden – im Steillagenkollektiv sind sie bereits heute ein fester Bestandteil. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Böden gesund bleiben und unsere Weine weiterhin von höchster Qualität sind!
Muschelkalk Terroir pur spürt, riecht und schmeckt man im Lemberger Blauer Stein.